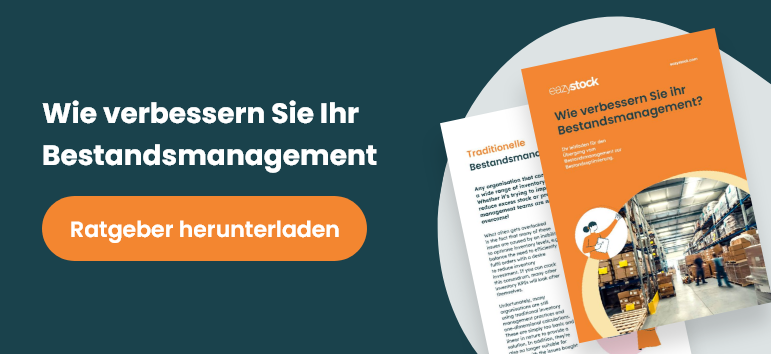Bestandssenkung im Lager: Was ist notwendig?
Auf dem Papier hört es sich der Begriff Bestandssenkung recht einfach an. In der Realität sind damit jedoch umfassende Maßnahmen verbunden, denn eine Bestandssenkung kann für das gesamte Unternehmen gravierende Folgen nach sich ziehen, sowohl positive, als auch negative.
Definition der Bestandssenkung
Die in einem Lager aufgebauten Bestände können unter Umständen nicht dem tatsächlichen Bedarf aus Absatz und Nachfrage entsprechen. Dieser Überbestand wird aber trotzdem meist aus Gründen der Liefersicherheit beibehalten. Im Besonderen bei der Lagerhaltung dauerhafter Güter durch Großhändler und Lieferanten zeigt sich hierbei eine im Prinzip unnötige Kapitalbindung und hohe Lagerkosten.
Eine Bestandssenkung ist technisch gesehen die Optimierung der Bestellvorgänge im Hinblick auf den Absatz, wobei verschiedene Parameter verändert werden. Sie kann auch eine Firmenphilosophische Note enthalten, wenn beispielsweise in dem jeweiligen Unternehmen ein traditioneller Ansatz zu einer großzügigen Lagerhaltung besteht, um dem Kunden eine hohe Lieferbereitschaft anbieten zu können.
Bestandssenkung Maßnahmen
Im Bereich der dauerhaften Güter kann eine unsichere Bestandsprognose bestehen, da gerade in diesem Teilbereich der Güterindustrie neben dem Markt der Neuwaren auch ein Gebrauchtgütermarkt besteht. Genau diese Unsicherheit wird durch Großhändler und Lieferanten über einen großen Lagerbestand kompensiert, wobei dieser Ansatz seine Richtigkeit haben kann, heute jedoch meist eine veraltete Strategie darstellt.

Im Gegensatz zum Facheinzelhandel sind Großhändler wie Lieferanten einem weit gefächerten Wettbewerb ausgesetzt, der sie in eine Situation zwingt, die eine schnelle Reaktion voraussetzt und dies unter der Maßgabe, möglichst aktuelle Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Dies widerspricht wiederum einem großen Lagerbestand, dessen Ursache jedoch die ungenaue Absatzvorhersage darstellt.
Wie kann dieser Zwickmühle mit den richtigen Bestandssenkung Maßnahmen entgegengewirkt werden?
Der erste Punkt ist die Analyse der Lieferantenvorgaben, von denen Großhändler ihre Produkte beziehen. Ein Hauptaugenmerk sind hierbei die Lieferzeiten, die Liefertreue, die Lieferstrecken und ob ein generelles Lieferantenrisiko besteht. Im zweiten Schritt erfolgt die vergleichende Analyse mit Konkurrenzprodukten anderer Lieferanten, die eventuell bisher aus kostentechnischen Gründen nicht berücksichtigt wurden. Bei allen Punkten ist die zentrale Gewichtung das just in time, um eine bedarfsgerechte Lieferung sicher zu stellen. So kann ein Lieferant eines Produktes eventuell teurer sein, in der Bestellstrategie fließen jedoch alle Kosten mit ein, so auch die nun verminderten Lagerkosten und die geringere Kapitalbindung.
Wie bereits erwähnt, funktioniert dies nicht mit allen dauerhaften Gütern, denn oft steht dem beispielsweise eine begrenzte Produktionszeit entgegen oder die Abgabe der Güter wird durch den Hersteller mengenmäßig gesteuert.
Bei der Umsetzung der Bestandssenkung Maßnahmen sollte quasi im Probetrieb die neuen Lieferanteneinstellungen getestet werden, funktionieren diese, kann mit dem Abbau des Lagerbestandes begonnen werden, wozu der Meldebestand abgesenkt wird. Inwieweit der Sicherheitsbestand abzusenken ist, hängt von den möglichen Szenarien innerhalb der neuen Lieferkette ab.
Ein weiterer Punkt ist die Bestandsbereinigung, denn gerade bei großen Lagerbeständen entstehen oft Lagerleichen, die nur Lagerkosten produzieren.
Bestandssenkung Strategien
Zur Bestandssenkung im Detail bestehen verschiedene Strategien, deren Anwendung von Großhändlern und Lieferanten anhand der von ihnen geführten dauerhaften Güter anzuwenden sind.
Diese Bestandssenkung Strategien unterteilen sich in technische Ansatzpunkte, organisatorische Maßnahmen sowie administrative Änderungen.
Der Bereich der technischen Ansatzpunkte zur Bestandssenkung besteht in der Kürzung der Durchlaufzeiten, eben einer Veränderung der Bestell- wie Lieferstrategie und eventuell auch eine Reduzierung der Teilevielfalt.

Die Maßnahmen zur Bestandssenkung im Bereich Organisation bezieht sich hauptsächlich auf die Lagerstruktur. Hierzu gehört eine ABC-Analyse sowie eine XYZ-Analyse der Güter, eine dynamische Bestellmengenberechnung, die Senkung der Sicherheitsbestände soweit möglich und eine Reduzierung innerhalb der Lager- bzw. Strukturstufen.
Im administrativen Bereich können die Maßnahmen zur Bestandssenkung eine Reduzierung der Variantenvielfalt beinhalten, etwa dann wenn dauerhafte Güter am Lager sind, die nur vereinzelt nachgefragt werden. Dies könnte auch die Grundlage zur Bildung eines Profitcenters sein, das sich innerhalb des Großhandelsunternehmens mit Sonderanfertigungen oder ähnlichem beschäftigt. Ein weiterer Administrativer Bereich sind die Serviceleistungen, deren Umfang geprüft werden sollte. Zu einer wirksamen Bestandssenkung kann auch die Reduzierung der Dispositions- und Entscheidungsebenen führen.
Software zur Bestandssenkung
Mithilfe einer Software zur Bestandsoptimierung lassen sich die weitaus meisten relevanten Punkte zu einer Bestandssenkung umsetzen, ohne dabei die Firmenstruktur unverhältnismäßig zu beeinflussen, beziehungsweise den Betriebsablauf zu stören. In der Regel besitzt das Unternehmen bereits ein ERP, an das die Software verbunden werden kann. Automatisierte und über die Software gesteuerte Vorgänge in Zusammenhang mit Analysen zu Lagerbeständen, Lieferanten und Kunden stellen Entscheidungshilfen dar und erlauben die Umsetzung der gewählten Strategie mit dem spürbaren Effekt der Kostensenkung.